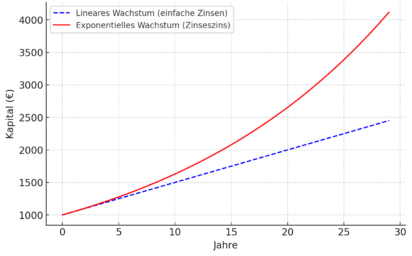Inflation und Deflation sind zwei gegensätzliche wirtschaftliche Phänomene, die direkten Einfluss auf Kaufkraft, Wirtschaftswachstum und Investitionen haben. Doch was bedeuten diese Begriffe genau, und welche Auswirkungen haben sie auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien oder Gold?
Was ist Inflation?
Inflation bezeichnet den allgemeinen Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum. Dies führt dazu, dass die Kaufkraft des Geldes abnimmt – mit derselben Menge Geld kann man weniger kaufen als zuvor.
Ursachen der Inflation:
- Nachfrageinflation: Wenn die Nachfrage nach Produkten das Angebot übersteigt, steigen die Preise.
- Kosteninflation: Wenn Produktionskosten (z. B. Rohstoffe, Löhne) steigen, werden diese an die Verbraucher weitergegeben.
- Geldmengeninflation: Wenn Zentralbanken mehr Geld in Umlauf bringen, steigt oft die Inflation.
Auswirkungen auf verschiedene Anlageklassen:
1. Aktien
- Unternehmen können steigende Kosten an Kunden weitergeben, sodass Unternehmensgewinne steigen.
- Jedoch können steigende Zinsen (eine typische Reaktion auf Inflation) die Finanzierungskosten für Unternehmen erhöhen, was negative Effekte haben kann.
- Historisch haben Sachwerte wie Aktien langfristig oft besser abgeschnitten als Bargeld oder Anleihen in Zeiten hoher Inflation.
2. Anleihen
- Inflation führt dazu, dass die realen Renditen von Anleihen sinken (weil die festen Zinszahlungen weniger wert sind).
- Besonders langfristige Anleihen verlieren an Attraktivität.
- Inflationsgeschützte Anleihen (z. B. inflationsindexierte Staatsanleihen) können eine Alternative sein.
3. Immobilien
- Sachwerte wie Immobilien profitieren oft von Inflation, da Miet- und Immobilienpreise mitsteigen.
- Allerdings können steigende Zinsen Kredite verteuern, was den Immobilienmarkt belasten kann.
4. Gold und Rohstoffe
- Gold wird oft als Absicherung gegen Inflation gesehen, weil es seinen Wert unabhängig von Währungen behält.
- Rohstoffe wie Öl oder Metalle tendieren dazu, mit der Inflation zu steigen, da ihre Produktionskosten ebenfalls steigen.
Was ist Deflation?
Deflation ist das Gegenteil von Inflation: Die Preise für Waren und Dienstleistungen sinken über einen längeren Zeitraum. Dies kann zunächst positiv erscheinen, da Konsumenten mehr für ihr Geld bekommen. Doch langfristig kann Deflation eine Wirtschaft stark belasten.
Ursachen der Deflation:
- Nachfragerückgang: Wenn Konsumenten und Unternehmen weniger ausgeben, sinken die Preise.
- Überproduktion: Wenn Unternehmen mehr produzieren, als nachgefragt wird, fallen die Preise.
- Geldmangel: Eine restriktive Geldpolitik oder sinkende Kreditvergabe können die Geldmenge verringern und zu Deflation führen.
Auswirkungen auf verschiedene Anlageklassen:
1. Aktien
- Deflation bedeutet oft geringere Unternehmensgewinne, was Aktienkurse belastet.
- Besonders zyklische Branchen (z. B. Industrie, Konsumgüter) leiden unter sinkender Nachfrage.
- Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen (z. B. Versorger oder Basiskonsumgüter) können sich besser behaupten.
2. Anleihen
- Da die Zentralbanken in der Regel die Zinsen senken, steigen die Kurse bereits existierender Anleihen.
- Besonders Staatsanleihen gelten in deflationären Zeiten als sicherer Hafen.
3. Immobilien
- Sinkende Preise und Einkommen können den Immobilienmarkt unter Druck setzen.
- Da Kreditkosten oft sinken, könnte das günstige Finanzierungen ermöglichen, aber Käufer zögern oft, wenn sie mit weiter sinkenden Preisen rechnen.
4. Gold und Rohstoffe
- Gold verliert oft an Attraktivität, da es keinen Zins oder Dividende bringt.
- Rohstoffe sinken meist im Preis, da die Nachfrage aus der Wirtschaft abnimmt.
Fazit
Inflation und Deflation beeinflussen Wirtschaft und Finanzmärkte auf ganz unterschiedliche Weise. Während Inflation Sachwerte wie Immobilien oder Aktien begünstigen kann, sind in deflationären Phasen Anleihen und liquide Mittel attraktiver. Ein ausgewogenes Portfolio, das verschiedene Assetklassen berücksichtigt, kann helfen, sich gegen beide Szenarien abzusichern.
Wer in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit investiert, sollte darauf achten, welche Phase vorherrscht, und entsprechend sein Portfolio anpassen.
→ weiter mit: Konjunkturzyklen – wirtschaftliche Auf- und Abschwünge